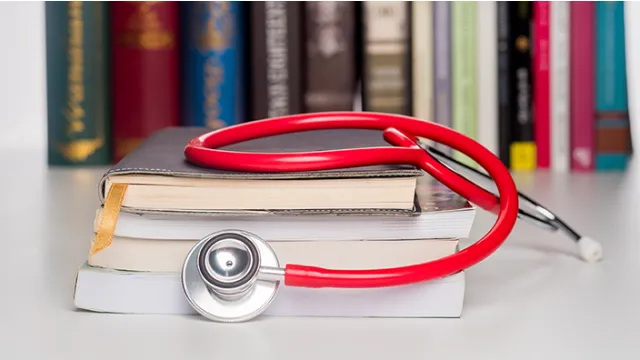Opioidnebenwirkung Dyspnoe
DER FAKTENCHECK
Sehr viele Palliativpatienten leiden unter Atemnot, teils kann diese extrem sein – bis hin zum tödlichen Ersticken.
Das Therapieziel ist eine schnelle Linderung mit einer Atemfrequenz im (hoch)normalen Bereich von etwa maximal 20–30 Atemzüge pro/Min. Damit wird die ineffiziente Totraumventilation unter der Tachypnoe wirksam therapiert. Zugleich wird die Sauerstoffaufnahme verbessert und der Sauerstoffverbrauch gesenkt.
Aber: Weltweit gibt es kein einziges Medikament, das für die Indikation Atemnot zugelassen worden ist. Warum auch? Denn altbewährte, verfügbare Fertig- oder Rezepturarzneimittel sind bestens bei Atemnot zur Symptomkontrolle geeignet. Wirtschaftlich ist es uninteressant, hierfür erforderliche Zulassungsstudien mit großem Aufwand durchzuführen.
(register.awmf.org/de/leitlinien/detail/128-001OL): Als Mittel der Wahl
„[…] sollen orale oder parenterale Opioide zur symptomatischen Linderung von Atemnot eingesetzt werden.“
„[…] Benzodiazepine können eingesetzt werden, wenn die Behandlung mit Opioiden nicht wirksam ist.“
In den meisten Beipackzetteln von Opioiden steht als häufige („kann bis zu 1 von 10 Patienten betreffen“) Nebenwirkung „Atemnot (Dyspnoe“). Auch und gerade Palliativpatienten und besonders ihre Angehörigen lesen diese Beipackzettel! Immer wieder kommt es vor, dass Opioide dann nicht genommen werden. Die Inhalte von Beipackzetteln müssen ernst genommen werden. Aber sie müssen auch mit Verstand und Sachkenntnis gelesen werden. Wenn Sie einem erstickenden Palliativpatienten einmal die Atemnot binnen Minuten lebensrettend gelindert haben – angemessen titriert mit Morphin i. v. oder Fentanyl nasal –, wird jeder überzeugt sein, Patienten gleichermaßen wie Zugehörige und kritische Behandler.
Deswegen gilt heute mehr denn je: Palliativmedizin gibt den Tagen mehr Leben und dem Leben mehr Tage!

Lehr- oder Leerstühle – da geht noch mehr!
PALLIATIVMEDIZIN IN DEN UNIVERSITÄTSKLINIKEN
 1224 wurde in Neapel eine medizinische in Fakultät gegründet. Seither wird Medizin in Europa universitär unterrichtet. In Deutschland gibt es inzwischen 44 medizinische Fakultäten.
1224 wurde in Neapel eine medizinische in Fakultät gegründet. Seither wird Medizin in Europa universitär unterrichtet. In Deutschland gibt es inzwischen 44 medizinische Fakultäten.
Erst 775 Jahre später, im Jahr 1999, konnte der erste Lehrstuhl für Palliativmedizin in Deutschland am Universitätsklinikum Bonn als eine Sackler-Stiftungsprofessur eingerichtet werden, im Jahr 2003 folgte der Lehrstuhl in Aachen durch die Grünenthal-Stiftung für Palliativmedizin.
Seitdem hat sich viel getan. Aber ist das genug? An gerade einmal 15 Universitäten existieren palliativmedizinische Lehrstühle und bei 29 fehlen sie noch.
Davon sind leider die Lehrstühle in Mainz und Würzburg nun schon länger nicht neu besetzt. Deswegen ist auf der Übersichtskarte rechts das Fähnchen am Pin auch traurig eingerollt. Hingegen gibt es in München zwar einen Lehrstuhl, aber gleich drei unabhängige Professuren, eine für Palliativmedizin, eine für Kinderpalliativmedizin und eine für Soziale Arbeit in Palliative Care; eine für Spiritual Care wurde nicht fortgeführt.
Was es noch nicht gibt, ist ein Lehrstuhl für Palliativversorgung, der primär und umfassend multiprofessionell ausgerichtet ist, lebt doch gerade die Palliativversorgung von der berufsübergreifenden Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Immerhin sind seit 2013 alle Universitäten verpflichtet, Palliativmedizin zu lehren. Aber hat ein Fachgebiet an einer Uni keinen eigenständigen Lehrstuhl, ist es schwierig, dieses Fach verbindlich und nachhaltig in der universitären Lehre zu verankern. Und das wäre für eine breite Implementierung hospizlich-palliativen Wissens bei allen Medizinstudierenden dringend erforderlich.
Zum Glück gibt es noch eine stetig wachsende Forschungslandschaft auf dem Gebiet der Palliativversorgung mit vielen wachen, palliaktiven Köpfen; hier finden interessierte Leser einen stets aktuellen Überblick.




 Weitere Info finden Sie unter: dgpalliativmedizin.de/wissenschaft/dgp-forschungslandschaft.html
Weitere Info finden Sie unter: dgpalliativmedizin.de/wissenschaft/dgp-forschungslandschaft.html